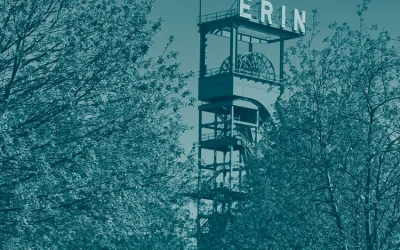Frau Meyer sitzt seit 30 Minuten im BEM-Gespräch. Das Problem ist klar: Der Lärm im Großraumbüro stresst sie, seit ihrer Rückkehr nach dem Burnout kann sie sich nicht mehr konzentrieren. Die Kopfschmerzen sind zurück, die Fehlerquote steigt. Der BEM-Berater fragt: „Was können wir für Sie tun?“
Frau Meyer seufzt: „Ich brauche Ruhe. Am besten Homeoffice.“
Der Vorgesetzte schüttelt den Kopf: „Homeoffice gibt es bei uns nicht. Da können wir nichts machen.“
Und schon steckt das BEM fest. Zwei unvereinbare Positionen stehen sich gegenüber. Das BEM-Gespräch droht zu scheitern, bevor überhaupt nach echten Lösungen gesucht wurde.
Kommt Ihnen das bekannt vor? In der Praxis erleben BEM-Berater immer wieder, dass Gespräche in eine Sackgasse geraten. Dabei gibt es bewährte Methoden, um aus solchen festgefahrenen Situationen herauszukommen und zu praktikablen Lösungen zu gelangen.
Warum viele BEM-Gespräche bei der Lösungsfindung scheitern
Oft wird im BEM zu schnell nach Lösungen gesucht – und dann die erstbeste Idee genommen. Oder es bleibt bei Positionen stecken wie „Ich brauche Homeoffice“ gegen „Das geht nicht“. Das Problem: Ohne systematische Lösungsfindung bleiben viele Möglichkeiten unentdeckt. Die Beteiligten erleben sich in einer Sackgasse, obwohl es oft zahlreiche Wege aus der Situation gibt.
Ein weiteres Problem: Technische Lösungen werden überschätzt. Der höhenverstellbare Schreibtisch, der ergonomische Stuhl, die neue Software – all das kann hilfreich sein. Aber bei komplexeren BEM-Fällen, besonders wenn Konflikte oder psychische Belastungen eine Rolle spielen, greifen rein technische Maßnahmen oft zu kurz.
Was fehlt? Eine strukturierte Herangehensweise, die systematisch verschiedene Lösungsmöglichkeiten entwickelt und dabei alle Beteiligten einbezieht.
Vom Problem zur Lösung: Der Problemlösekreis
Neben dem klassischen Brainstorming bieten sich strukturierte Verfahren an. Besonders bewährt hat sich der Problemlösekreis, der zwischen dem Besonderen und dem Allgemeinen pendelt. Der Grundgedanke: Wenn wir verstehen, wie Probleme dieser Art generell entstehen und gelöst werden, finden wir auch für unseren konkreten Fall bessere Lösungen.
Schritt 1: Das konkrete Problem definieren
Zurück zu Frau Meyer: Das konkrete Problem lautet: „Die Beschäftigte fühlt sich durch den Lärm im Großraumbüro gestresst und kann sich nicht konzentrieren.“
Schritt 2: Die allgemeinen Ursachen erfassen
Wie kommt es generell zu solchen Problemen? Zu viele Reize, fehlende Möglichkeiten Reize auszublenden, hohe Ablenkung, ständige Unterbrechungen, kein Rückzugsort vorhanden.
Schritt 3: Allgemeine Lösungsansätze sammeln
Wie werden solche Probleme generell gelöst? Die Entstehung der Reize verhindern, die Reize dämpfen, die Person von den Reizen trennen, die Quelle kapseln, den Empfänger kapseln, die Reaktion auf die Reize mildern, Ausweichmöglichkeiten schaffen.
Schritt 4: Konkrete Lösungen für die Situation ableiten
Jetzt wird es praktisch. Welche dieser allgemeinen Lösungen lassen sich auf Frau Meyers Situation anwenden?
- Die Beschäftigte arbeitet in einem gesonderten Raum oder Besprechungsraum für konzentrierte Arbeit
- Sie trägt Noise-Cancelling-Kopfhörer oder Gehörschutz
- Sie arbeitet zu ruhigeren Zeiten (früh morgens, später Nachmittag)
- Lärmdämmende Materialien werden im Büro angebracht
- Ruhezonen werden eingerichtet
- Bestimmte Bereiche werden als „Lärmzonen“ definiert, andere als „Ruhezonen“
- Telefonate werden in separaten Räumen geführt
- Teilweise Homeoffice für konzentrierte Aufgaben, Präsenz für Besprechungen
Plötzlich gibt es nicht mehr nur zwei Optionen (Homeoffice ja oder nein), sondern mindestens acht verschiedene Lösungsansätze, die kombiniert werden können!
Die STOP-Maßnahmenhierarchie für vielfältige Lösungen
Aus dem Arbeitsschutz kennen Sie vermutlich die STOP-Maßnahmenhierarchie. Diese lässt sich hervorragend für die Lösungsfindung im BEM nutzen. STOP ist ein Akronym: Substitution, Technik, Organisation, Person.
S wie Substitution
Schädigende oder konfliktträchtige Aspekte werden durch weniger problematische ersetzt. Bei Frau Meyer könnte das bedeuten: Der unpassende Arbeitsplatz im lauten Großraumbüro wird durch einen passenden Platz in einem ruhigeren Bereich ersetzt. Unscharfe Aufgabenstellungen, die zu ständigen Rückfragen führen, werden durch klare, eindeutige Ziele ersetzt.
Praxisbeispiel: Ein Mitarbeiter mit Rückenproblemen kann schwere Pakete nicht mehr heben. Statt ihn krankschreiben zu lassen oder zu versetzen, werden die schweren Aufgaben substituiert: Er übernimmt die Qualitätskontrolle und Dokumentation, während Kollegen die körperlich belastenden Tätigkeiten übernehmen.
T wie Technik
Mit welchen technischen Mitteln lässt sich das Problem lösen? Bei Frau Meyer: Externe Anrufe werden per Rufumleitung an die Zentrale durchgestellt, Lärmdämpfungsmatten werden eingebaut, Noise-Cancelling-Kopfhörer werden zur Verfügung gestellt, Raumteiler schaffen optische und akustische Trennung.
Praxisbeispiel: Eine Pflegekraft mit Schulterproblemen kann Patienten nicht mehr ohne Hilfsmittel bewegen. Ein Deckenlifter wird installiert, die Betten werden auf die richtige Arbeitshöhe eingestellt, ein elektrisch höhenverstellbarer Rollstuhl erleichtert den Transfer.
O wie organisatorische Maßnahmen
Die Arbeitszeiten werden so gelegt, dass möglichst in den Nebenzeiten gearbeitet wird. Für konzentrierte Arbeiten wird ein Einzelbüro oder Besprechungsraum genutzt. Aufgaben werden neu verteilt. Pausen werden flexibel gelegt.
Praxisbeispiel: Ein Mitarbeiter mit Diabetes muss regelmäßig essen und seinen Blutzucker kontrollieren. Die Pausenzeiten werden flexibilisiert, ein ruhiger Rückzugsort für die Blutzuckermessung wird eingerichtet, bei Unterzuckerung darf er jederzeit eine kurze Pause nehmen.
P wie Person
Im Arbeitsschutz wäre dies der Einsatz der persönlichen Schutzausrüstung wie ein Gehörschutz. Im BEM-Kontext bedeutet dies zusätzlich: Die Person weist klar auf Störungen hin, lernt durch Konzentrationsübungen sich besser auf Aufgaben zu konzentrieren, nutzt Entspannungstechniken in Stresssituationen.
Wichtig: Während im Arbeitsschutz die Schritte eine Priorisierung der Maßnahmen abbilden (Substitution vor Technik vor Organisation vor Person), können im BEM diese Lösungsbereiche gleichrangig behandelt werden. Oft ist eine Kombination aus allen vier Bereichen die beste Lösung.
Die Kopfstandmethode: Kreativ denken durch Umkehrung
Manchmal hilft es, das Problem auf den Kopf zu stellen. Die Kopfstandmethode startet mit der Frage: „Was können wir tun, um das Problem zu verschlimmern?“
Zurück zu Frau Meyer. Was würde ihre Situation verschlechtern?
- Noch mehr Lärm erzeugen
- Ihren Arbeitsplatz neben die lauteste Abteilung setzen
- Ständig unterbrechen und stören
- Keine Rückzugsmöglichkeiten bieten
- Ihr noch mehr parallele Aufgaben geben
- Deadlines verkürzen und Druck erhöhen
- Ihre Bedenken ignorieren
Im nächsten Schritt werden diese Punkte umgedreht – und plötzlich haben Sie eine Liste von Erfolgsfaktoren:
- Lärmquellen reduzieren
- Einen ruhigen Arbeitsplatz schaffen
- Unterbrechungen minimieren
- Rückzugsmöglichkeiten einrichten
- Fokus auf eine Aufgabe zur Zeit ermöglichen
- Realistische Zeitplanung
- Ihre Bedürfnisse ernst nehmen und einbeziehen
Wichtig bei dieser Methode: In der Formulierung sollte keine Verneinung vorkommen. Also nicht „Wir beabsichtigen, uns nicht anzuschreien“, sondern „Wir sprechen sachlich und konstruktiv über Differenzen“.

Von vielen Ideen zur besten Lösung: Strukturierte Entscheidungsfindung
Jetzt haben Sie viele Lösungsmöglichkeiten gesammelt – aber welche ist die beste? Hier hilft eine strukturierte Entscheidungsfindung. Die durch die verschiedenen Methoden gewonnenen Lösungsmöglichkeiten sollten zunächst gewürdigt werden. Die Vielzahl an Möglichkeiten kann das Gefühl der Hilflosigkeit mindern und die Motivation der Beteiligten erhöhen, aktiv an der Lösung mitzuwirken.
Die vielfältigen Lösungsmöglichkeiten können nach Themen oder Kategorien geordnet werden, um einen besseren Überblick zu gewinnen. Manchmal können auch unterschiedliche Möglichkeiten miteinander kombiniert oder zusammengefasst werden.
Entscheidungskriterien festlegen
Nach der Sammlung der Ideen sollten diese nach festgelegten Merkmalen bewertet werden. Dafür sollten zuerst Entscheidungskriterien formuliert werden:
- Juristische Kriterien: Ist die Lösung rechtlich zulässig? Erfüllt sie die Vorgaben des BEM?
- Wirtschaftliche Kriterien: Welche Kosten entstehen? Ist die Lösung verhältnismäßig?
- Wissenschaftliche/medizinische Kriterien: Ist die Lösung fachlich sinnvoll? Was sagt der Betriebsarzt?
- Praktikabilität: Lässt sich die Lösung im Arbeitsalltag umsetzen?
- Akzeptanz: Können alle Beteiligten die Lösung mittragen?
- Schnelligkeit der Umsetzung: Wie lange dauert die Implementierung?
Die Rangreihenbildung
Manchmal lohnt es sich, eine strukturierte Entscheidungsfindung vorzunehmen, um die Akzeptanz der Lösung zu verbessern. Eine Methode hierfür ist die Rangreihenbildung.
Dazu wird eine Tabelle erstellt. In den Spalten stehen die Lösungsalternativen, in den Zeilen die Kriterien. Für jedes Kriterium werden die Alternativen in eine Rangreihe gebracht – an erster Stelle steht die Alternative, die dieses Kriterium am besten erfüllt, an letzter Stelle die, die es am wenigsten erfüllt. Am Ende wird für jede Alternative die Summe aus den Rangreihenplätzen gebildet. Die Alternative mit der geringsten Summe ist die beste Wahl.
Beispiel für Frau Meyer:
| Kriterium | Vollständiges Homeoffice | Einzelbüro | Noise-Cancelling-Kopfhörer | Flexible Zeiten in Ruhezonen |
|---|---|---|---|---|
| Schnelle Umsetzbarkeit | 4 (langwierig) | 3 | 1 (schnell) | 2 |
| Kostengünstig | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Teamintegration | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Akzeptanz Führungskraft | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Lärmreduktion | 1 (optimal) | 1 | 2 | 3 |
| Summe | 17 | 11 | 6 | 9 |
In diesem Beispiel schneiden die Noise-Cancelling-Kopfhörer am besten ab, gefolgt von den flexiblen Zeiten in Ruhezonen. Eine Kombination aus beiden könnte die optimale Lösung sein.
Win-Win statt Win-Lost
Es gibt aus Beratersicht zwei wichtige Kriterien für die Entscheidung: Die Akzeptanz der Beteiligten und die Vorteile für alle Beteiligten. Wenn nur eine Partei Vorteile von der Lösung hat, ist es eine Win-Lost-Lösung, die oft der Auftakt für eine erneute Konfliktrunde ist.
Die Wahrnehmung von Fairness einer Lösung ist eng verknüpft mit der Einschätzung der Vorteile, die die andere Seite daraus zieht. Wenn eine Seite das Gefühl hat, die andere würde mehr davon profitieren, wird dies oft als ungerecht empfunden.
In solchen Fällen sollte, gerade wenn ein unmittelbarer Nutzen fehlt, ein Ausgleich in anderer Form geschaffen werden, damit beide Seiten die Lösung wirklich als gerecht empfinden.
Beispiel: Die vom Mitarbeitenden bevorzugte Lösung (Homeoffice) ist für die Führungskraft die unangenehmste. Wenn stattdessen eine Kombination aus Ruhezonen und flexiblen Zeiten gewählt wird, könnte als Ausgleich für den Mitarbeiter zusätzlich eine Reduzierung der parallelen Projekte vereinbart werden – ein Vorteil, der ihm wichtig ist und die Führungskraft wenig belastet.
Die SMART-Formel für klare Vereinbarungen
Wenn die Lösung ausgewählt wurde, gilt es diese in einer Abschlussvereinbarung zu fixieren. Eine Formulierung sollte sich an der bekannten SMART-Formulierung anlehnen, die hier angepasst vorgestellt wird:
S wie sinnvoll: Die Lösungsformulierung sollte in einem größeren Zusammenhang eingebunden sein. Auf diese Weise werden das Verständnis und die Akzeptanz der Vereinbarungen gefördert.
M wie messbar: Es soll definiert werden, woran erkannt werden kann, dass das Ziel erreicht wurde. Damit können Missverständnissen vorgebeugt werden.
A wie attraktiv oder zumindest akzeptabel: Die Zielerreichung sollte für die Akteure möglichst anziehend sein, wenn dies nicht möglich ist, sollte es zumindest annehmbar sein, damit die Motivation zur Zielerreichung gegeben ist.
R wie realistisch: Nur subjektiv realistische Ziele führen auch zu einer Zielbindung. Wenn der Akteur glaubt, das Ziel nicht erreichen zu können, wird er auch wenig bis nichts in die Zielerreichung investieren.
T wie terminiert: Hier gilt festzulegen, bis zu welchem Zeitpunkt oder zu welchem Zeitpunkt das Ziel erreicht werden soll. „Demnächst“ ist keine akzeptable Formulierung. Eine wenn-dann-damit-Formulierung ist hilfreich.
Beispiel einer SMART-Vereinbarung für Frau Meyer:
„Ab dem 1. März erhält Frau Meyer Noise-Cancelling-Kopfhörer (Beschaffung bis 28. Februar) und kann täglich zwischen 14:00 und 16:00 Uhr den Besprechungsraum 3 für konzentrierte Arbeiten nutzen. Die Teamleiterin informiert das Team über die neue Regelung, ohne Details zu Frau Meyers Gesundheitszustand zu nennen. Nach vier Wochen (Ende März) findet ein Feedbackgespräch statt, um zu prüfen, ob die Maßnahmen wirken und Frau Meyer sich wieder besser konzentrieren kann. Messkriterium: Die Fehlerquote sollte auf das Niveau vor der Erkrankung sinken, und Frau Meyer sollte subjektiv eine deutliche Verbesserung spüren.“
Alle Punkte der Vereinbarung sollten konkret beschrieben werden, um Missverständnisse zu vermeiden. Die Vereinbarung sollte auch flexibel genug sein, um bei Bedarf angepasst werden zu können, falls sich die Umstände ändern.
Der psychologische Effekt: Von der Sackgasse zur Lösungsvielfalt
Die Sammlung vieler Lösungsmöglichkeiten hat einen wichtigen psychologischen Effekt: Zu Beginn erlebten sich die Beteiligten meist in einer Sackgasse – Frau Meyer sah nur Homeoffice als Lösung, die Führungskraft sah gar keine Möglichkeit. Nun sehen sie plötzlich viele Optionen. Durch die Vielzahl der gesammelten Ideen können innovative und kreative Lösungen entstehen, die vorher nicht in Betracht gezogen wurden.
Auch scheinbar unrealistische oder ungewöhnliche Ideen sollten berücksichtigt werden, da sie oft neue Perspektiven eröffnen und Denkblockaden überwinden können. Diese neuen Ansätze können nicht nur den aktuellen Konflikt lösen, sondern auch langfristig zu einer besseren Zusammenarbeit und einem stärkeren Zusammenhalt der Beteiligten führen.
Ein kleines Ritual zum Abschluss
Wenn die Abschlussvereinbarung festgelegt wurde, empfiehlt es sich, ein kleines Ritual durchzuführen. Dies kann ein Handschlag sein, die Unterschrift auf dem Flipchart, auf dem die Lösung geschrieben wurde, oder ein gemeinsames Foto der Beteiligten. Solche Rituale verbessern die Zielbindung, weil dadurch ein psychologischer Vertrag geschlossen wird.
Die Parteien sollten für ihre Bemühungen und die erzielte Einigung gelobt werden. Ihnen sollte Mut für die zukünftige Zusammenarbeit gemacht werden. Dieses Vorgehen fördert das Verständnis und die Akzeptanz der Vereinbarungen. Auch sollte ein realistischer Optimismus im Hinblick auf die Umsetzung der Vereinbarung zum Ausdruck gebracht werden.
Fazit: Systematisch statt spontan
Erfolgreiche Lösungsfindung im BEM ist keine Glückssache. Mit strukturierten Methoden wie dem Problemlösekreis, der STOP-Maßnahmenhierarchie und der Kopfstandmethode entwickeln Sie systematisch vielfältige Lösungen. Die Rangreihenbildung hilft bei der objektiven Auswahl. Und SMART-formulierte Vereinbarungen sorgen dafür, dass die Lösung auch wirklich umgesetzt wird.
Der Unterschied zu spontanem Brainstorming: Sie bleiben nicht bei den erstbesten oder naheliegendsten Ideen stecken. Sie denken strukturiert vom Problem über allgemeine Ursachen und Lösungen zu konkreten, umsetzbaren Maßnahmen. Sie beziehen verschiedene Lösungsbereiche ein – von Substitution über Technik und Organisation bis zur Person.
Das Ergebnis: Statt „Das geht nicht“ entstehen praktikable Lösungen, die für alle Beteiligten akzeptabel sind. Statt Konflikte zu verwalten, lösen Sie sie. Und genau darum geht es im BEM: Die Arbeitsfähigkeit nicht nur wiederherstellen, sondern nachhaltig sichern.